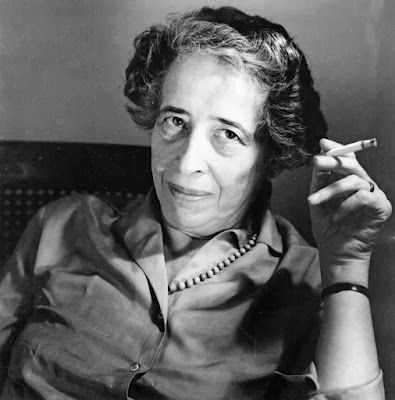Mit den beiden großen Heldenepen Homers, der Ilias und der Odyssee,
beginnt im 8. Jahrhundert v. Chr. nicht nur die griechische, sondern die
gesamte abendländische Literaturgeschichte. Insbesondere die Ilias stellt in
Stoffgestaltung, Erzählung, Einzelbild und dramatischer Gestaltung das alles
überragende erste Referenzwerk europäischer Literatur dar. Dies gilt zum einen
für die literarische Gestaltung, zum anderen aber auch für die geschilderten
Ereignisse, die man in der Antike für historisch hielt.
 |
| Handschrift eines Teiles des 8. Buches der Illias (Illias Ambrosiana, 5./6. Jh.) |
Die Ilias ist allerdings auch ein wichtiger Markstein für
das Thema Gewalt und die von Homer hierzu entworfenen Bilder sind besonders
wirkmächtig.
Das Thema der Ilias ist nicht, wie man anhand des erst
Jahrhunderte später entstandenen Titels vermuten könnte, der zehn Jahre
dauernde Troianische Krieg, sondern nur ein kleiner Ausschnitt von 51 Tagen.
Homer verdichtet auf diese Weise meisterhaft die mit dem Krieg verbundenen
Grundkonflikte zwischen Göttern und Menschen wie der Menschen untereinander.
Das eigentliche, schon im ersten Vers benannte Thema ist der
Groll des Achill, der sich von dem großen Heerführer Agamemnon zurückgesetzt
fühlt, da dieser ihm Briseis, eine als Kriegsbeute Achill zustehende und
bereits zugeteilte Frau, streitig gemacht hat. Achill verweigert daraufhin,
ganz in gekränkter Ehre zürnend, den Kampf – mit verheerenden Folgen.
 |
| Agamemnon und Achill - Mosaik aus Pompeii |
Mit dem Konflikt zwischen Agamemnon und Achill, dem nicht
endenden Groll Achills und der Situation am troianischen Königshof lotet Homer
sämtliche Bereiche zwischenmensch-licher Konflikte und Befindlichkeiten aus. In
zahllosen Einzelepisoden werden die Menschen in Bewährung und Versagen
vorgeführt.
Zentraler Aspekt ist ferner das Adelsethos der archaischen
Zeit, das in allen Nuancen durchgespielt wird. Hierzu gehört auch, dass Achills
Verweigerung in zweifelhaftem Licht erscheint und so die Grenzen der ewigen
Gewaltbereitschaft benannt werden. Freundschaft, Gastfreundschaft, Ehe,
Solidarität, Verpflichtung gegenüber den Vorfahren, Bewährung im Kampf,
Witwenschaft wie Waisennot und anderes mehr werden vor dem Hintergrund des
Krieges thematisiert und reflektiert.
Man hat im moralisch-ethischen wie sozialen Gehalt den
Wesenskern, das eigentliche dichterische Anliegen, erkennen wollen, für das der
Troianische Krieg selbst nur den Hintergrund lieferte. Dies hat viel für sich
und erklärt gut die Faszination, die vom Epos ausgeht und die Wirkmächtigkeit
ebenso wie eine breite, die Zeiten überdauernde Rezeption sicherte.
Dennoch nimmt die Schilderung von Kämpfen und Schlachten
rund zwei Drittel des gesamten Werks ein: In 16 der 24 Gesänge werden
Schlachten beschrieben. Sage und schreibe 318 tote Krieger, von denen 243 Namen
tragen, werden in den Kampfszenen einzeln vorgeführt, wobei sie auf rund 60
verschiedene Todesarten sterben. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer namenloser
Kämpfer und Verwundeter.
Auf den modernen Leser wirken die langen Kampfbeschreibungen
ermüdend. Der antike Zuhörer hingegen scheint diese Partien besonders goutiert
zu haben. Anders ist sonst der prominente Platz der Kampfschilderungen nicht zu
erklären. Bei der Zusammenführung der vielen Einzelepisoden wird Homer
jedenfalls die Publikumserwartungen bedacht haben, die den wandernden Sängern,
den Rhapsoden bestens vertraut gewesen sein dürfte, da sie selbst dem Adel
angehörten.
Aus heutiger Sicht ist nicht nur der Umfang der Schlachtschilderungen
irritierend, sondern auch die detailversessene Beschreibung von Verletzungen
und Todesarten. Die anatomisch exakt anmutende Wiedergabe von Kriegs- und
Kampfverwundungen ließ im 19. Jahrhundert einen Gelehrten sogar vermuten, bei
Homer habe es sich um einen griechischen Militärarzt gehandelt, der bestens mit
den Wunden vertraut war, welche die zeitgenössischen Waffen wie Pfeile, Speere
und Schwerter geschlagen hatten.
 |
| Kupferstich von John Flaxman zur Ilias (1793) |
In vielen Fällen werden die Protagonisten kurz vorgestellt
und ihre Herkunft erläutert, ehe Homer den Zweikampf selbst schildert. Am Ende
steht in der Regel der Tod eines Kämpfers, der auf sehr unterschiedliche Weise
beschrieben wird. Zunächst gibt es einfach ausgemalte Szenen, in denen der
kurze Hinweis den Todesstoß zusammenfasst:
Der Speer „durchbohrte die Stirn, und die eherne Spitze
drang in die Knochen, und ihm umhüllte Dunkel die Augen“ (4, 460 f.). In einem
anderen Fall fährt die Lanze in „die Brust neben der Warze, rechts, und gerade
durch die Schulter“ (4, 480 f.). Einem wieder anderen Krieger drang die Waffe
„in die Schläfe, und durch die andere Schläfe drang die eherne Spitze“ wieder
heraus (4, 502 f.). In weiteren Kämpfen wird schlicht der Kopf abgeschlagen
(11, 261).
Alle Teile des Körpers sind von den Verletzungen betroffen,
wobei zwischen den Kriegsparteien ein wichtiger Unterschied besteht. Die Troianer
haben häufiger Rückenverletzungen, was ihrer Rolle im Epos durchaus entspricht,
denn sie sind es, die häufiger auf der Flucht gezeigt werden.
Die Achäer, Agamemnon und seine Mitkämpfer, werden im Epos
bisweilen wie wilde Tiere, vor allem wie Eber und Löwen beschrieben, die
entsetzliche Verletzungen anrichten können. Odysseus etwa wütet mit einem Gefährten,
„wie wenn zwei Eber sich unter jagende Hunde stürzen“ (11, 324 f.). Agamemnon
kämpft gar wie ein Löwe, der einer Kuh (d.h. einem Troer) nachstellt: „Er packt
sie und bricht ihr den Nacken heraus mit den starken Zähnen zuerst und schlürft
dann das Blut und die Eingeweide“ (11, 175 f.). Diesem grausigen Bild
entsprechend beschreibt Homer den Tod einzelner Troer, wie beispielsweise den
des Diores, der im Kampf von einem Wurfgeschoss getroffen worden war, das ihm „die
beiden Sehnen und die Knochen zerschmetterte“ (4, 521).
Weiter heißt es: „Der
aber fiel rücklings nieder / in den Staub, und breitete beide Arme aus nach
seinen Gefährten, / den Lebensmut verhauchend. Doch der lief herbei, der ihn
getroffen, / Peroos, und stieß mit dem Speer in den Nabel, und alle / Gedärme
ergossen sich auf die Erde, und ihm umhüllte Dunkel die Augen“ (4, 522–526).
 |
| Der Tod des Sarpedon |
Anderen Kämpfern fährt der Speer in den Kopf, und „das
Gehirn wurde drinnen ganz mit Blut vermengt“ (12, 185 f.; 20, 399 f.). Einer
wird getroffen „unter dem Kinnbacken und dem Ohr, und die Zähne stieß hinaus
das Ende des Speers und schnitt mitten durch die Zunge“ (17, 617 f.).
Besonders eindrücklich ist das Bild des Mannes, der im
Rücken getroffen wird, wobei die Lanze den gesamten Körper durchdringt. Er
sinkt nieder, „und eine Wolke umhüllte ihn, eine schwarze, und er zog an sich,
zusammengesunken, die Eingeweide mit den Händen“ (20, 417 f.). Einem
Unterlegenen wird der Kopf unter dem Ohr abgeschlagen, „und nur die Haut hielt
noch, und seitwärts herab hing der Kopf“ (16, 340 f.).
Besonders kleinteilig ist die Beschreibung der Verletzung,
die Pandaros erleidet. Die Lanze wird von der Göttin Athene „auf die Nase neben
dem Auge (gelenkt), und sie durchbohrte die weißen Zähne. Und ihm schnitt ab
die Wurzel der Zunge das unaufreibbare Erz, und die Spitze fuhr ihm heraus am
untersten Kinn.“ (5, 291–293).
 |
Achills´ Kampf am Fluss
Johann Balthasar Probst
(1673 - 1748) |
Eine Lanze trifft „in den Schenkel, wo der dickste Muskel
des Menschen ist, und rings um die Spitze der Lanze zerrissen ihm die Sehnen“
(16, 314‒316), einen „Oberarm schälte des Speeres Spitze aus den Muskeln und
schmetterte den Knochen gänzlich herunter“ (16, 323 f.).
Eindrucksvoll ist auch der Tod des Erymas (16, 345–350): „Idomeneus aber stieß dem Erymas in den Mund mit dem
erbarmungslosen Erz, / und gerade hindurch fuhr hinten heraus der eherne Speer,
/ unterhalb des Gehirns, und spaltete die weißen Knochen. / Und
herausgeschüttelt wurden die Zähne, und es füllten sich ihm / mit Blut die
beiden Augen, und aus dem Mund und durch die Nasenlöcher / sprühte er es,
klaffend.“
(Fortsetzung folgt)
aus: Martin Zimmermann: Gewalt. Die dunkle Seite
der Antike, München 2013