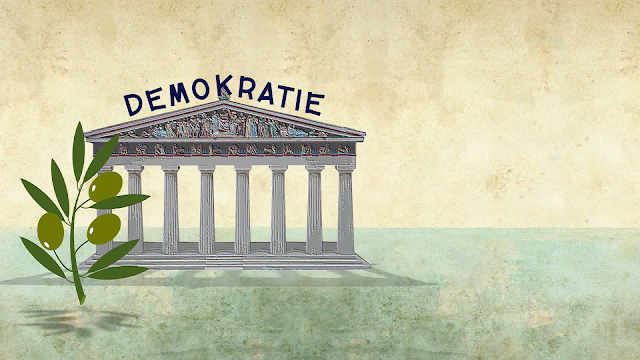Demokratie ist aktuell wie kaum zuvor – und wirft wie nie zuvor Fragen auf. In seinem Buch „Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart“ verknüpft Paul Nolte die historischen Perspektiven und grundsätzlichen Fragen mit den aktuellen Problemen und zeigt auf, dass die Geschichte der Demokratie nie nur von Wachstum, Fortschritt und Erfüllung handelte. Sie war immer zugleich eine krisenhafte Suche nach der Auflösung von Konflikten und Widersprüchen.
Während gemeinhin die Griechen als die Erfinder der Demokratie steht Rom für das „Imperium Romanum“, bis heute eine „Chiffre für einen globalen Herrschafts-anspruch, der mit überlegenen militärischen Mitteln gesichert wird, im Innern aber Lebenskraft und Freiheit verliert.“
 |
| Das Römische Reich nach dem Tod Caesars |
Aber nicht erst in der Kaiserzeit, schon in der Zeit der Republik lässt sich eine beständige Ausweitung des Machtbereichs Roms beobachten, ausgehend von Italien, über Nordafrika, West- und Mitteleuropa und den östliche Mittelmeerraum bis in den nahen Osten. Dieser Aufstieg vollzog sich im politischen Rahmen einer „Republik“, seit die Römer am Beginn des 5. Jahrhunderts die Königsherrschaft der Etrusker abgeschüttelt hatten. Aus heutiger „war damit ein Verfassungstyp etabliert, der in der Neuzeit (…) eine gewaltige Anziehungskraft entfaltete; eng verknüpft und doch nicht identisch mit der Neubegründung der Demokratie. Republik, das war und ist die Staatsform einer Selbstregierung, die nicht auf die Führung durch Könige oder Kaiser, auch nicht durch Diktatoren, angewiesen ist – also das Gegenteil von Monarchie (und teils auch von Diktatur).“
„Res publica“ bezeichnete – durchaus in Anlehnung an die griechischen Begriffe „Eunomie“ oder „Politeia“ - eine gute und stabile politische Ordnung. Auch wenn der Römischen Republik „ein Bewusstsein ihrer Verfassung im modernen Sinne“ fehlte – eine schriftlich niedergelegte Verfassung gabe es nicht – so erhob die „Res Publica“ doch den Anspruch, das Volk an der Herrschaft zu beteiligen. Dafür spricht schon die Herkunft und Bedeutung des Wortes „publicus“: „Die `res publica´ sei die `res populi´, die Sache des Volkes, legte Cicero in seiner Schrift über die Republik dem Scipio Africanus in den Mund.
Res publica, das ist aber zuerst die `öffentliche Sache´: das, was der gemein-schaftlichen Verhandlung und Regelung bedarf. Das inzwischen altmodische Wort «Gemeinwesen» ist eine Übersetzung davon. Die Unterscheidung zu den `res privata´, modern gesprochen also: zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, konnten die Römer in der Antike schon klarer ziehen als die Athener.“
Im weiteren Verlauf der Geschichte der Republik breitete sich folglich auch ein Bewusstsein von der Gefährdung dieser Ordnung aus, die man vor Schaden oder mutwilliger Zerstörung zu bewahren habe. „Das spiegelt sich in der berühmten Formel des Staatsnotstandes, des `senatus consultum ultimum´: `Die Konsuln mögen zusehen, dass die Republik keinen Schaden nehme´ (videant consules ne quid res publica detrimenti capiat).“
 |
| "Die Konsuln mögen zusehen, dass die Republik keinen Schaden nehme!" Cicero´s Rede im Senat gegen Catalina (Hans Werner Schmidt, 1859-1940) |
Dennoch war die Römische Republik keine Demokratie. Macht und Einfluss in Rom lagen zunächst in der Hand adliger Familien. Angesichts der zunehmenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation begannen die Plebejer, sich politisch zu organisieren. „Dabei spielten zwei Institutionen eine wichtige Rolle: das Volkstribunat und die Volksversammlungen. Die Volkstribune agierten gegenüber der aristokratischen Herrschaft und den durch sie bestellten Amtsträgern als eine Art Sprecher oder Sachwalter des Volkes.“
Die verschiedenen (!) Volksversammlungen dagegen sind nicht mit der Bürger-versammlung Athens vergleichbar, sondern existierten nebeneinander und beruhten teils auf dem regionalem (Wohnort-)Prinzip, teils auf Familienverbänden oder auf militärischen Einheiten spiegelten.
Das aristokratische Machtzentrum Roms jedoch bildete der Senat. Senator wurde man nicht durch Wahl oder Losung, sondern man wurde Mitglied des Senates nach dem Ausscheiden aus einem politischen Amt, das man in der Regel für ein Jahr ausübte. „Diese Ämter, mit den Konsuln an der Spitze, bildeten einen charakteristischen Teil der republikanischen Verfassung. Manches an ihnen erinnert an heutige `basisdemokratische´ Prinzipien: Man hatte ein Amt immer nur für ein Jahr inne (`Annuität´) und konnte es danach auch nicht erneut übernehmen; man teilte sich zumeist die Ausübung mindestens zu zweit – das Prinzip der Kollegialität.
Aber obwohl die Volksversammlungen die Magistrate wählten, spielten Einfluss, Geld und die Herkunft aus bestimmten Familien dabei eine entscheidende Rolle. In der späteren Republik etablierte sich sogar immer mehr ein fester Karriereverlauf, der `cursus honorum´. Man begann als relativ junger Mann in einem niedrigen Anfangsamt als Quästor oder Ädil und stieg von dort weiter auf, möglichst bis zum Konsulat.“
 |
| Der cursus honorum in der Republik und in der Kaiserzeit |
Bis zu ihrem Ende blieb die Republik also eine im Wesentlichen aristokratische Verfassung mit einigen `popularen´, also das Volk einbeziehenden Elementen, wie in der Souveränitätsformel SPQR `Senatus populusque Romanus´ (der Senat und das Volk von Rom) zum Ausdruck kommt. Eine Demokratie war das gleichwohl nicht, weil das Volk zwar Anteil an der Herrschaft hatte, aber sie nicht in `demokratischen´ Institutionen (wie sie die Athener besaßen) ausübte.
Es fehlten auch die sozialen Voraussetzungen für eine Demokratie. „Die römische Gesellschaft dagegen blieb vertikal strukturiert, nicht nur in Hinsicht auf ökonomische Ungleichheit oder die (…) Differenz zwischen Patriziern und Plebejern. Sie beruhte auf persönlichen und familiären Abhängigkeitsverhältnissen, in denen Herr und Abhängiger, `Patron´ und `Klient´ in der Sprache Roms, einander Schutz und Dienste leisteten. Unabhängigkeit und politische Freiheit konnten in diesem Klientelsystem nicht entstehen.“
Während Rom sich auf die Sitten der Vorväter berief, den „mos maiorum“, die es zu achten gelte, erfordert „Demokratie“ ein Bewusstsein von der menschlichen und gegenwärtigen Machbarkeit einer neuen, auch gegen Herkommen und Tradition gerichteten Ordnung des Politischen.
Dennoch: Die Römische Republik entwickelte eine Vielzahl von Institutionen, „die in abgewandelter Form als unverzichtbarer Bestandteil moderner Demokratien gelten, mindestens aber als ihre Voraussetzung. Dazu gehört eine Rechtsordnung, die freilich erst in der Zeit des Kaiserreichs zu voller Entfaltung kam und die dem Prinzip Bahn brach, (berechenbare) Gesetze und nicht (willkürliche) Personen sollten herrschen.“
Auch wenn dem römischen Bürgerbegriff die egalitäre - griechisch die „isono-mische“ - Dimension fehlte, so sei, schrieb Cicero, das Gesetz das Band der bürger-lichen Gesellschaft, in der der „civis romanus“ – der römische Bürger – seinen festen Platz hat.
Als wichtigste Innovation aber erwies sich die Erfindung der Republik als solche selbst, als Gegenprinzip zur Monarchie. Gerade in der Frühgeschichte der Demokratie waren es Republiken – wenn auch aristokratisch befangen -, die dem Selbstverständnis moderner Demokratien den Weg bereiteten, „nicht zuletzt im Sinne eines normativen Appells an Recht, Öffentlichkeit und Gemeinwohlbezug, an dem sich der Gebrauch von Macht messen lassen muss. Denn wie die Römer schon wussten, existiert die `res publica´ – wir würden heute übersetzen: die Demokratie – immer schon in Gefährdung, und ist deshalb eine zu verteidigende.“
Zitate aus: Paul Nolte: Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart“, München 2012 (C.H. Beck)